Der Linguistische Ansatz des NLP; Die Metasprache
Die Linguistik ist wohl jener Teil des NLP, der als
erster von Grinder und Bandler entwickelt wurde. In ihrem Buch Die Struktur der Magie I
(1990) bearbeiten sie an Hand von Therapietransskriptionen die Problematik der Sprache. Im
speziellen sind es die Arbeiten der Therapeuten Fritz Perls und Virginia Satier bei denen
sie entdeckten, daß beide eine ganz bestimmte Art und Weise hatten, ihre Fragen zu
stellen wenn sie Informationen über die Welt des Klienten sammelten. Diese Welt ist, wie
weiter oben schon dargestellt, vergleichbar mit einer Landkarte, in der die lebenslangen
Erfahrungen eingetragen sind. Diese Erfahrungen werden im Zuge der Kommunikation auch
über Worte transportiert. Jedes Wort hat dabei in jedem Menschen seine individuelle
Assoziation. Da wir alle in einer Welt leben und eine sehr ähnliche Neurologie besitzen,
sind die Landkarten im Grunde genommen ähnlich. Ohne diese Tatsache wäre eine
Verständigung schier unmöglich. Der NLP - Praktiker geht aber nicht davon aus, daß ein
von ihm gesprochenes Wort, deren Bedeutung er selber ja erfahren hat, beim
Kommunikationsempfänger zwangsläufig die gleichen Assoziationen auslöst. Die Anwort auf
die Frage Was bedeutet ein Wort wirklich? kann deshalb nur lauten: Für wen? (CONNOR,
SEYMOR 1992, S. 144). So haben beispielsweise Eskimos sehr viele verschiedene Wörter für
unser einziges deutsches Wort Schnee. Für die Erfahrung Auto haben wir in der westlichen
Kultur sehr viele Worte entgegen etwa einem Menschen in Neuguinea, der für die Erfahrung
Reis 92 verschiedene Terme kennt. Die Komplexität der Erfahrung und der daraus
resultierenden Sprache (Sprache ist ein Resultat der gemachten Erfahrungen) ist abhängig
von der Kultur. Simon geht weiter davon aus, daß die Komplexität des Denkens ein Abbild
der Umwelt ist in der es geschieht (vgl SIMON 1994). Innerhalb des NLP wurde ein Modell,
eine nützliche Landkarte davon entwickelt, wie Sprache funktioniert. Das sogenannte
Metamodell benutzt die Sprache, um Sprache zu erklären. Sämtliche unserer Erfahrungen
sind in einer neurologischen Tiefenstruktur gespeichert. Darin ist die sensorisch
aufgenommene und verarbeitete Information enthalten. Müßte der Mensch nun direkt diese
Erfahrungen kommunizieren, wäre ein Gespräch sehr umständlich. Würde jemand z.B. in
einer größeren Stadt nach einer bestimmten Straße fragen und er bekommt als Antwort die
Erklärung, wie sich diese Straße historisch, bautechnisch, sozial usw. entwickelt hat,
wäre ein gesellschaftliches Miteinander sehr schwierig. Deshalb wird zur Kommunikation
die Erfahrung der Tiefenstruktur in eine Oberflächenstruktur gewandelt und erst dann
über die Sprache kommuniziert (Bild 2.11).
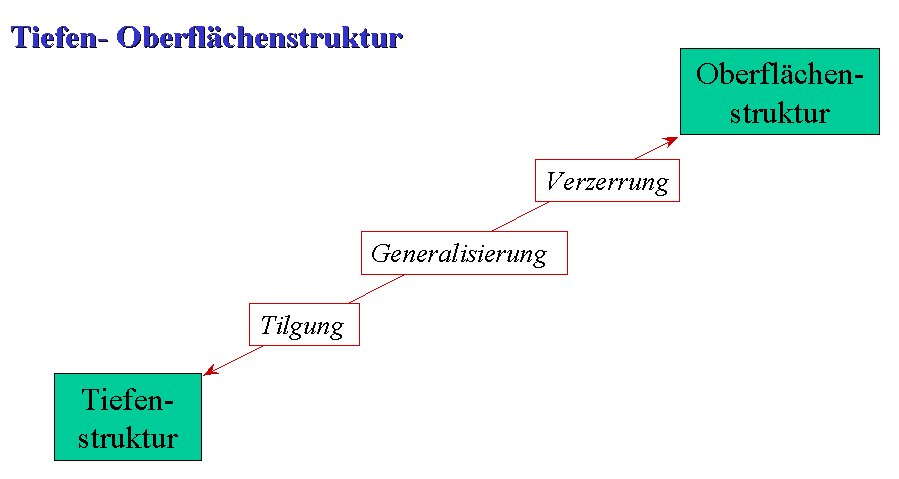 Bild 2.11
Bild 2.11
Der Absender hat eine sehr genaue Vorstellung von dem, was er weitergeben möchte. Sein
Gehirn arbeitet mit einer wesentlich höheren Geschwindigkeit als sein Sprechwerkzeug.
Umgekehrt löst ein gesprochenes Wort beim Empfänger eine Vielfalt neurologischer
Assoziationen aus. Ob es nun genau die richtige, d.h. die vom Absender gewünschte ist,
kann nur durch exakte Kommunikation mit permanentem Feedback sichergestellt werden. Auf
dem Weg von der Tiefenstruktur zur Oberflächenstruktur geht eine Menge an Informationen
verloren. Es wird nur ein Teil des vorhandenen Wissens selektiert. Ein großer Teil wird
einfach ausgelassen (Tilgung). Außerdem wird nur eine sehr vereinfachte Version von dem
wiedergegeben, was der ursprünglichen Erfahrung entspricht (Verzerrung). Und letztendlich
siehe Beispiel Straßennamen wird nur eine sehr allgemeine Information, also ohne
Ausnahmen und Bedingungen weitergegeben (Verallgemeinerung). Der Prozeß innerhalb jeder
Kommunikation, der Tilgungen, Verzerrungen und Verallgemeinerungen beinhaltet, ist
grundsätzlich als natürlich anzusprechen. Im Störungsfall, also bei psychischen
Problemen, Lernschwierigkeiten, schlechter Kommunikation usw., ist es günstig, ein
Instrument zu haben, mit dem die tatsächlich in der Oberflächenstruktur enthaltenen
verborgenen oder fehlenden Informationen verifiziert werden kann. Es handelt sich dabei um
eine Reihe von Fragen, mit denen versucht wird, Tilgungen, Verzerrungen und
Verallgemeinerungen der Sprache umzukehren und zu entwirren (CONNOR, SEYMOR 1992, S. 150).
Im folgenden wird das Metamodell der Sprache etwas differenzierter dargestellt.